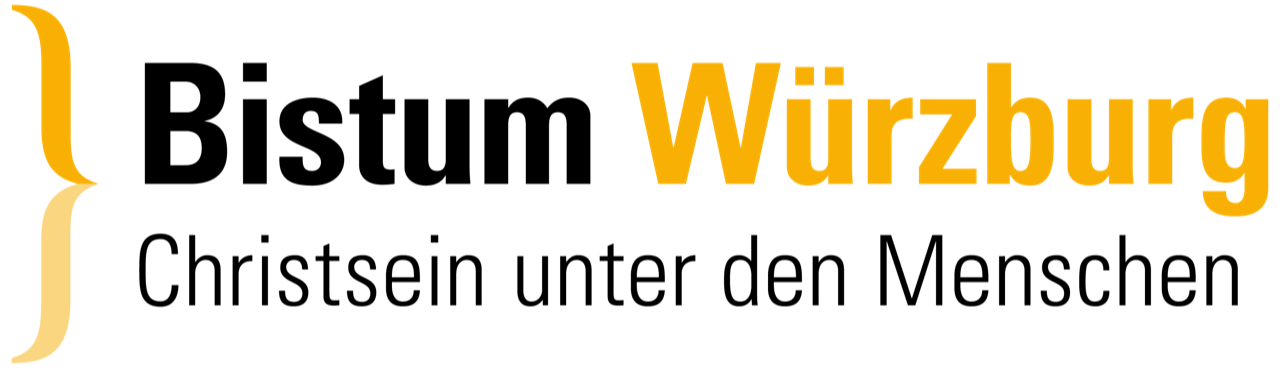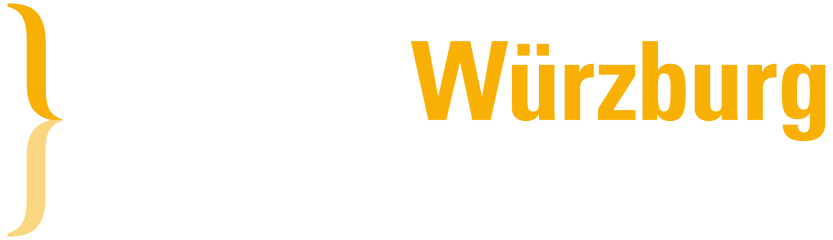Wer etwa möchte auf Elektrizität verzichten und die vielen Helfer, die mit ihr betrieben werden? Andererseits wird uns immer mehr die Ambivalenz dieser Entwicklung bewusst: Die Annehmlichkeiten sind vielfach teuer erkauft mit der Schädigung der Umwelt, dem Verbrauch endlicher Ressourcen und einer Entfernung von den natürlichen Lebensgrundlagen, ja letztendlich deren Zerstörung. Da dem Menschen aber Verzicht und Umkehr schwer fallen, ist die Versuchung groß, den Ausweg aus dieser bedrohlichen Lage in noch mehr, noch besserer, noch effektiverer Technik zu suchen.
Das mag sogar Teil der Lösung sein, verstärkt aber eine Tendenz, die ebenfalls zur Besorgnis Anlass gibt. Technische Entwicklungen werden zunehmend nur nach Nützlichkeit oder Wirtschaftlichkeit bewertet. Ethisch-moralische Gesichtspunkte treten in den Hintergrund. Ohnehin hat man den Eindruck, dass die Ethik mit der Geschwindigkeit des technischen Fortschritts schon lange nicht mehr mithalten kann. Diese Problematik hat Papst Franziskus unlängst bei einer Begegnung mit Mitgliedern der Max-Planck-Gesellschaft aufgegriffen, und zwar im Blick auf die Idee des Transhumanismus, der Verknüpfung von kognitiven Fähigkeiten des Menschen mit maschineller Rechenleistung. Diese Hinwendung zum „hybriden Denken“ verändere die Spezies homo sapiens grundlegend und werfe erhebliche ethische und soziale Fragen auf, sagte der Papst. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, dürfe nicht von der Notwendigkeit getrennt werden, zu verstehen, wozu und nach welchen ethischen Maßstäben man handelt, sagte er und wandte sich gegen ein rein technisches Verständnis von Verantwortung, das die moralische Beurteilung, was gut und böse ist, ausschließe. Die Bereitschaft, umzukehren und auch zu verzichten, scheint aktueller denn je zu sein – und das nicht nur für 40 Tage.
Wolfgang Bullin