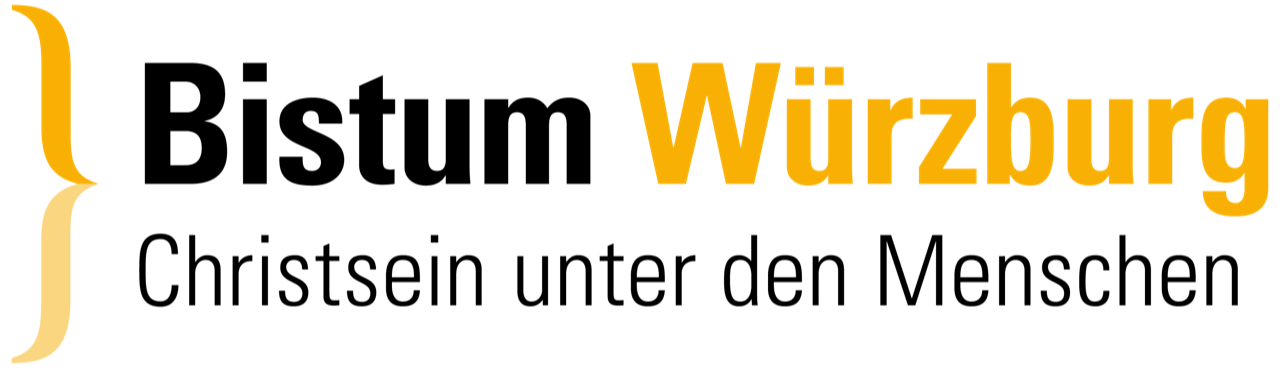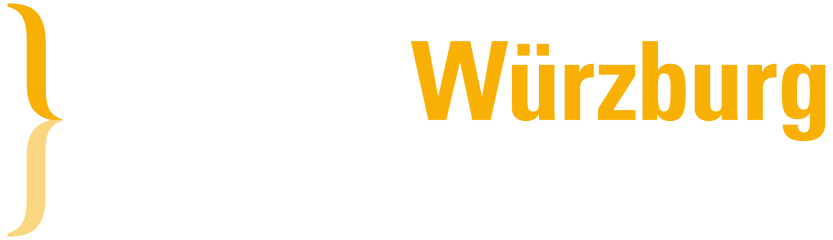Würzburg/München (POW) Das Institut für Therapieforschung München (IFT) erforscht seit 1984 pathologisches Glücksspielverhalten. Dr. Ludwig Kraus, stellvertretender Institutsleiter, erklärt in folgendem Interview, wieso Menschen überhaupt vom Glücksspiel abhängig werden und warum das Spiel am Automaten riskanter ist als das wöchentliche Lottospiel.
POW: Menschen können nach vielen verschiedenen Dingen süchtig werden: Alkohol, Zigaretten, Drogen... Warum kann auch Glücksspiel süchtig machen?
Dr. Ludwig Kraus: Im Zusammenhang mit Glücksspiel spricht man zwar umgangssprachlich von Sucht, aus diagnostischer Sicht wird pathologisches Glücksspielverhalten aber als „Impuls-Kontrollstörung“ eingestuft und nicht unter dem Begriff „Sucht“ subsummiert. Die Nähe zur Sucht ergibt sich über die Ähnlichkeit einiger Symptome wie beispielsweise dem Kontrollverlust, dem starken Drang zum Spielen oder der Fortsetzung des Glücksspielverhaltens trotz negativer sozialer und finanzieller Folgen.
POW: Sind Alkohol und Zigaretten nicht eigentlich viel schädlicher als das Glücksspiel?
Kraus: Bezüglich der Folgen muss man zwischen physischen, psychischen und sozialen Folgen unterscheiden. Die Folgen des Tabakkonsums sind in erster Linie Krankheit und frühzeitige Sterblichkeit. Beim Glücksspiel sind die Folgen eher sozialer und finanzieller Natur, zum Beispiel Störungen des Familienlebens oder Schulden. Tabak und Glücksspiel – das lässt sich einfach nicht gegeneinander aufrechnen.
POW: Sie haben das Thema „Kontrollverlust“ schon angesprochen. Was ist genau damit gemeint?
Kraus: Trotz des Vorsatzes, nur eine bestimmte Zeit oder nur einen bestimmten Geldbetrag zu spielen, wird so lange weitergespielt, bis man aufhören muss – entweder wegen der Höhe des Verlustes oder weil die Spielhalle geschlossen wird.
POW: Welche Faktoren begünstigen die Abhängigkeit? Gibt es bestimmte Muster, die bei allen Süchtigen immer wieder auftreten?
Kraus: Es wird in der Regel zwischen stoffgebundenen und nicht-stoffgebundenen Süchten unterschieden. Stoffgebundene Süchte sind Süchte, bei denen Stoffe wie Alkohol oder Nikotin konsumiert werden. Nicht-stoffgebunden heißt, dem Körper werden keine psychoaktiven Substanzen zugeführt. Manche Wissenschaftler vermuten in der Ätiologie (Fachrichtung der Medizin, die sich mit der Ursache von Krankheiten beschäftigt, Anm. d. Red.) stoffgebundener und nicht-stoffgebundener Süchte große Ähnlichkeiten. Als bekannte Risikofaktoren für stoffgebundenes Suchtverhalten gelten ein Wechselspiel aus genetischen Faktoren, Persönlichkeits- und Umweltfaktoren. So ist insbesondere ein früher Beginn ein hoher Risikofaktor für spätere Abhängigkeit. Zu den Risikofaktoren des pathologischen Glücksspielverhaltens ist bisher noch sehr wenig bekannt. Der Übergang zwischen kontrolliertem Spiel und pathologischem Glücksspiel ist aber Gegenstand intensiver Forschung.
POW: Sind eigentlich alle Glücksspiele ähnlich süchtig-machend oder gibt es Unterschiede? Von welchem Spiel, welchen Spielen geht die größte Gefahr aus?
Kraus: Die Risiken für pathologisches Glücksspielverhalten unterscheiden sich tatsächlich nach Glücksspielart. Sie sind beim Lotto weit geringer als bei Glücksspielautomaten, Sportwetten oder Spielbanken.
POW: Warum ist das so?
Kraus: Glücksspiele haben verschiedene Eigenschaften, auf die gefährdete Spieler unterschiedlich reagieren. Spiele mit kurzen Intervallen wie zum Beispiel Glücksspielautomaten, das Setzen von Jetons beim Roulette oder das Kartenspiel, beispielsweise Pokern, sind sehr schnell. Sie nehmen die Konzentration der Person voll in Anspruch und sind geeignet, dass sie Spieler dazu verführen, den potentiellen Verlusten nachzujagen. Diese Konstellationen haben ein höheres Risikopotential als zum Beispiel Lotto mit wöchentlichen Gewinnmöglichkeiten.
POW: Ab wann spricht man eigentlich von pathologischem Glücksspiel? Wenn jemand einmal pro Monat Lotto spielt, wenn er einmal pro Woche in die Spielothek geht, wenn er täglich online pokert?
Kraus: Die Häufigkeit des Spielens hängt zwar mit pathologischem Glücksspielverhalten zusammen, ist aber nicht damit gleichzusetzen. Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen, die erfüllt sein müssen, um die Diagnose pathologisches Glücksspiel zu erfüllen. Dazu zählen zum Beispiel mehrmalige erfolglose Versuche, das eigene Glücksspiel zu reduzieren, Spielen mit hohen Beträgen, um den Reiz des Spiels zu erhöhen, hoher Zeitaufwand im Zusammenhang mit Glücksspiel wie Geldbeschaffung oder das intensive Nachdenken über Spielstrategien.
POW: Wenn Sie könnten, würden Sie das Glücksspiel in Deutschland verbieten?
Kraus: Der Sachverhalt ist zu komplex, als dass man ihn mit einfach Ja oder Nein beantworten könnte. Glücksspiel ist in Deutschland grundsätzlich verboten und wird daher bereits staatlich kontrolliert. Notwendig sind transparente Regulierungen, die dem gesellschaftlichen Umgang mit Glücksspiel als auch den Erfordernissen der Prävention und der Verhinderung von negativen Folgen gerecht werden.
POW: Gibt es in Deutschland eigentlich ein ausgeprägtes Bewusstsein für das Problem, die Krankheit „Glücksspielsucht“?
Kraus: Ausgelöst durch die Debatte um das Monopol des Staates als Anbieter von Glücksspielen wurde das Thema „Glücksspielsucht“ ins öffentliche Interesse gerückt. Das Problem selbst wird aber wie bei Alkohol und Tabak weit unterschätzt.
(0310/0087; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Foto abrufbar im Internet