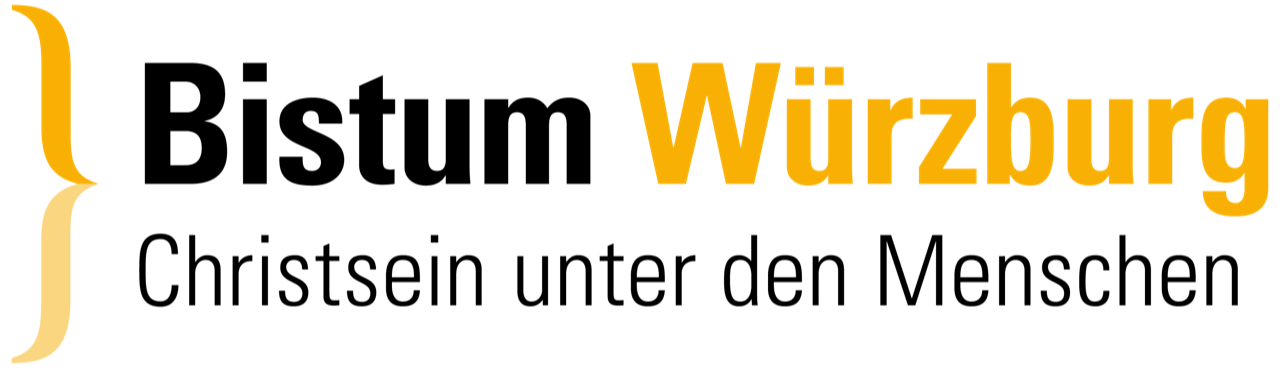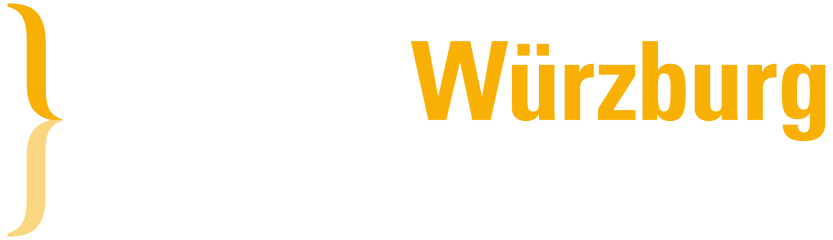Im Rahmen des Mozartfestes dürfen wir heute in diesem Pontifikalamt mozartsche Musik erleben, die uns innerlich erreicht und beschwingt: Die sogenannte ‚Spatzenmesse’. Die Spannung zwischen der sichtbaren Schöpfung und der uns im Glauben verkündeten unsichtbaren Wirklichkeit wird durch die Musik zu einem besonderen Erlebnis.
Rainer Maria Rilke hat in einem Vers seines Gedichtes „An die Musik“ das Wesen der Musik aufleuchten lassen: „Musik – Du Sprache, wo Sprachen enden“. Gerade die Musik, die nach Heinrich Heine „zwischen Materie und Geist, zwischen Zeit und Ewigkeit steht“, vermag den Menschen in seinem Innersten zu berühren und über sich selbst hinaus zu heben.
Zugleich aber hat die Musik im Gottesdienst die Möglichkeit, den Bogen zwischen der unsichtbaren himmlischen und der quasi sichtbaren, das heißt, hörbaren irdischen Musik zu schlagen. Wenn in der Heiligen Schrift von der himmlischen Liturgie die Rede ist, dann doch vornehmlich im Zusammenhang mit der Musik.
So schilderte schon Jesaja in einer Vision, wie der Saum des Gewandes Gottes den Tempel ausfüllte und wie er die Serafim jubilieren hörte: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.“ (Jes 6,3)
Und in der Apokalypse, dem letzten Buch des Neuen Testamentes, berichtet Johannes von den durch Christi Blut Geretteten: „Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. Und sie sangen eine neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten.“ (Apk 14,2f.)
Die Musik, die wir heute in diesem Pontifikalamt hören, hat einen hohen Stellenwert in der Kirche. Sie ist von Anfang an nicht nur als schmückendes Dekor, als Beiwerk oder als eine Überhöhung der Feier gesehen worden, sondern sie ist Bestandteil der Liturgie. So heißt es im Konzil: „Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen, vor allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen integrierenden Bestandteil der feierlichen Musik ausmacht.“ (Kleines Konzilskompendium, VI, 112, S. 84).
Wir hörten eben im Markus-Evangelium von einer Frau, die schon zwölf Jahre unter Blutungen litt. Obwohl sie von vielen Ärzten behandelt worden war, ihr ganzes Vermögen dabei ausgegeben hatte und viele Schmerzen ertragen musste, war ihr Zustand noch schlimmer geworden. In ihrer Not drängte sie sich durch die Menge, um Jesus zu berühren. Sie hatte von ihm gehört und sagte sich: „Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt.“ (Mk 5,28). Und in der Tat, sofort hörte die Blutung auf. Markus überliefert: „…sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war.“ (Mk 5,29). Aber auch Jesus hatte gespürt, dass ihn jemand berührt hatte und eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er fragte, wer sein Gewand berührt hatte. Die Frau gestand es „zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war; sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit.“ Die Reaktion Jesu ist nicht nur auf diese Frau hin gesprochen, sondern gilt auch für uns: „Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.“ (Mk 5,34)
Hat dieses nicht auch etwas mit der Musik zu tun? Musik im Gottesdienst ist für mich so etwas wie eine geistige Jakobsleiter. Sie verbindet die sichtbare, empirisch erfahrbare geschöpfliche Wirklichkeit mit der uns im Glauben verkündeten und erschlossenen Realität Gottes. Musik berührt unser Innerstes und hat eine heilende Wirkung. Sie berührt gleichsam auch den Saum des Gewandes Gottes und lässt uns von ihm her eine tiefe Freude, Klarheit und Geborgenheit zuwachsen, die ganz konkret in unser persönliches Leben hineinreicht. Uns wächst durch die Musik eine heilende Kraft zu, die nicht näher definierbar aber zutiefst erfahrbar ist.
Musik erklingt zwar nur im Augenblick, erreicht dabei aber unser Herz. Sie klingt nach und erschließt Räume, von denen wir auf einmal spüren, dass hier mehr zu erleben ist als menschliches Können, Kompositions- und Interpretationsgabe. Das Erlebnis der Musik übersteigt den sichtbaren, empirisch und denkerisch erfahrbaren Grund und führt wie eine Brücke zur ungeschaffenen Wirklichkeit, zu Gott.
In Gott fallen beide Wirklichkeiten, Diesseits und Jenseits, Wissen und Glauben, zusammen. Wenn schon der geniale Komponist in seinem eigenen schöpferischen Tun erlebt, dass das, was in seinen Noten gerinnt mehr ist als das, was er selbst zu geben vermag, so empfindet dies erst recht auch der Hörer.
Die Musik gibt uns von Gott auf eine mittelbare Weise Zeugnis. Sie erweckt Emotionen, spricht Verstand und Herz an und führt so über jedes rationale Erkennen hinaus in den Raum Gottes. Sie verweist zugleich auf unsere zukünftige Vollendung im Himmel, von der es in der Geheimen Offenbarung des Johannes heißt: „Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserm Gott.“ (Apk 19,1) Amen.