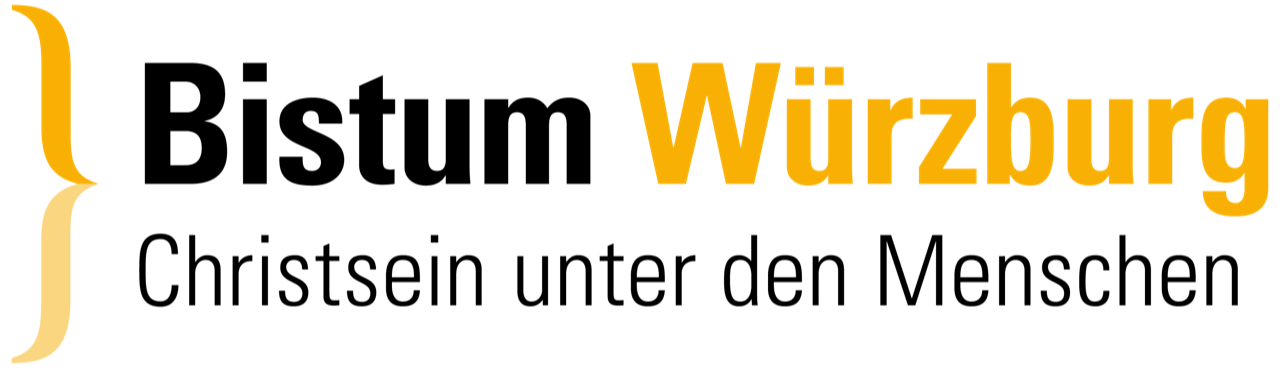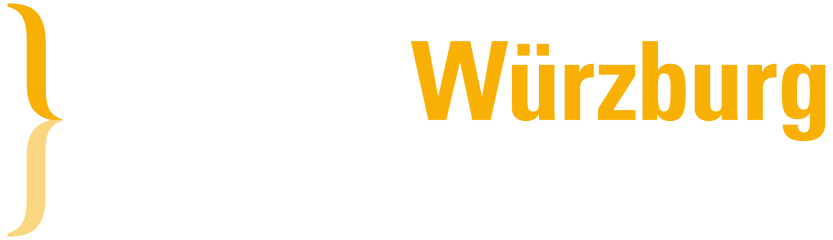Gute Hirten
Rund um den Erdkreis feiert die katholische Kirche heute den Sonntag vom guten Hirten. In Amorbach können wir das in besonderer Weise tun. Morgen sind 100 Jahre vergangen seit ein großer Sohn dieser Stadt, der Erzbischof Franz Joseph Stein, heimgerufen wurde. 30 Jahre lang wirkte er als Oberhirte: 19 davon im Bistum Würzburg, 11 in der Erzdiözese München-Freising. In der Nachfolge Christi hat Bischof Stein als guter Hirte gelebt und gewirkt. Von Jesus Christus, dem einzigartigen guten Hirten, fällt Licht auf sein Leben; wiederum kann sein Wirken uns helfen, dass wir besser verstehen, was unser Herr für uns ist und für uns tut. Indem wir uns dankbar an Franz Joseph Stein erinnern, schauen wir auf zu dem guten Hirten Jesus Christus, der uns kennt wie keiner und der uns liebt, wie niemand sonst in der Welt, der sein Leben für uns hingibt. Er ist der Ursprung der Hirtendienste, die Bischof Franz Joseph Stein wahrgenommen hat. An ihrer Spitze steht sein Glaubenszeugnis.
Hirtendienste
Zeuge der Liebe
Das II. Vatikanische Konzil hatte als erste Aufgabe der Bischöfe die Verkündigung des Evangeliums herausgestellt: „Denn die Bischöfe sind Glaubensboten, die Christus neue Jünger zuführen; sie sind authentische, das heißt mit der Autorität Christi ausgerüstete Lehrer. Sie verkündigen dem ihnen anvertrauten Volk die Botschaft zum Glauben und zur Anwendung auf das sittliche Leben.“ Bischof Stein hat diese Aufgabe hervorragend wahrgenommen. Seine seelsorglichen und katechetischen Erfahrungen, seine langjährige Tätigkeit als Universitätsprofessor der Moral und der Pastoral haben ihn optimal darauf vorbereitet. So konnte er bereits in seinem ersten Hirtenwort die wichtigste Glaubenswahrheit in bewegenden Worten verkünden. An den Anfang seiner „ersten Oberhirtenpredigt“ stellte er „den größten Gedanken, welche die Welt je vernommen“ hat: die „beseligende Wahrheit“: „Gott ist die Liebe, und die Welt, die ganze Schöpfung ist das freie Werk seiner herablassenden, überströmenden Liebe. Aus Liebe und nur aus Liebe Gottes sind wir zum Dasein gelangt, und aus der gnädigen, unendlich huldreichen Liebe des göttlichen Geistes sind wir zur Gemeinschaft mit ihm berufen worden.“ Gott, der die Liebe ist, ruft uns hinein in sein Lieben. Das ist der tiefste Sinn unseres Daseins und zugleich der Gipfel dessen, was wir in unserem ganzen Leben erreichen können. Eindringlich sagt der Bischof seinen Diözesanen: „Ihr habt ja nicht etwa nötig, erst zu dem Morgenlande hinzupilgern, um die Liebe zu suchen, oder eine Seereise gegen Westen zu unternehmen, um jene zu finden: mit Gottes Gnade könnt ihr die Liebe zu ihm immer und überall pflegen, sie üben und bewähren an jedem Orte.“ Sorgt dafür, dass eure Liebe ähnlich der Liebe Gottes „eine kräftige, fröhliche Liebe der Tat“ ist !
All das erinnert uns an die erste Enzyklika, die Papst Benedikt XVI. uns geschenkt hat. Auch sie gilt der Wahrheit „Gott ist die Liebe“ und zugleich unserer Berufung, immer mehr Mitliebende zu werden. Er schreibt: „Liebe wächst durch Liebe. Sie ist >göttlich<, weil sie von Gott kommt und uns mit Gott eint, uns in diesem Einungsprozess zu einem Wir macht, das unsere Trennungen überwindet und uns eins werden lässt, so dass am Ende >Gott alles in allem< ist.“
Unter den verschiedenen Diensten, die Bischof Stein wahrgenommen hat, ragt sein Einsatz für den Frieden heraus. Er war ein Mann des Friedens.
Mann des Friedens
Bereits seine Ernennung war ein Friedenssignal. Drei Jahre lang musste die Diözese auf einen Bischof verzichten. Kirche und Staat konnten sich nicht auf einen Kandidaten einigen. Das wurde erst bei Franz Joseph Stein möglich. Er war ein angesehener Universitätsprofessor, an dessen Treue zur Kirche kein Zweifel bestand. Zugleich sah die bayerische Regierung in ihm einen fairen Partner. Dass man sich darin nicht getäuscht hat, zeigt die spätere Berufung Steins nach München. Bei seinem Amtsantritt bluteten noch manche Wunden, die der Kulturkampf geschlagen hat. Übergriffe des Staates hatten dazu geführt, dass etliche sich von ihm distanzierten und so ihrer Weltverantwortung nicht gerecht wurden. Selbst innerhalb der Diözesanen war es zu erheblichen Polarisierungen gekommen. Hier musste der Bischof sich als Pontifex, als Brückenbauer bewähren. Das war nicht immer leicht. Beide Seiten argwöhnten, er würde ihnen nicht gerecht. Bischof Stein tat was er konnte. Sein Friedensdienst war selbst in der Theologie gefordert. Auch in der theologischen Fakultät der Universität gab es Polarisierungen, die sich mehrfach schlimm auswirkten. Ein Opfer war der Priester Herman Schell, der heute als ein Vorbereiter des II. Vatikanischen Konzils angesehen wird. Bischof Stein hat ihn bereits früh gefördert. Er stand ihm treu zur Seite. Als es erhebliche Schwierigkeiten gab, bot er ihm an, mit ihm über diese „con amore“, also mit Liebe zu sprechen . Als die Streitigkeiten zu eskalieren drohen, mahnt Stein zum Frieden. Er nimmt in Kauf, dass manche seinen Friedensdienst missverstehen und attackieren. Er hält an seinem Ziel fest; es lässt sich mit der Devise von Papst Pius XI. wiedergeben: „Friede Christi im Reiche Christi“. Es hat seinen tiefen Sinn, dass er seinen ersten Hirtenbrief mit den Worten des hohepriesterlichen Gebets Christi um die Einheit abschließt: „Heiliger Vater, erhalte jene in deinem Namen, die du mir gegeben hast; heilige sie in der Wahrheit, damit keiner aus ihnen verloren gehe, und dass sie dich, den einzigen wahren Gott erkennen und Jesum Christum, welchen du gesandt hast“ (Joh 17,3.11.17).
In diesem Sinn übt Bischof Stein seinen Hirtendienst als Hüter und Helfer aus.
Hüter und Helfer
Als guter Hirt sagt unser Erlöser: „Ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne“ (Joh 10,14f.). In der Nachfolge Christi hat Bischof Stein sich bemüht, seine Diözesanen so gut wie möglich kennenzulernen. In seiner Amtszeit hat er zweimal alle Gemeinden besucht. Das war damals nicht so leicht wie heute, wo man mit dem Auto relativ schnell auch in weit entfernten Pfarreien sein kann. Mit der Kutsche dauerte es erheblich länger; zudem waren die weiten Reisen recht strapaziös. Über die Besuche hinaus sucht Bischof Stein den Kontakt mit den Priestern durch vermehrte Pastoralkonferenzen. Ihm ist zu verdanken, dass es erstmals seit der Reformation zu einer geordneten Seelsorge in der Thüringer Diaspora kam. Nicht vergessen sei der Einsatz des Bischofs für die Arbeiterschaft. So förderte er den Aufbau des katholischen Arbeitervereins, der in Würzburg 1890 gegründet wurde. In wenigen Jahren entstanden 63 Zweigvereine.
Allen in der Diözese kam die Einführung des „Ave Maria“ zugute. Den Älteren unter uns ist es noch vertraut. Generationen sind mit der Hilfe dieses Gebet- und Gesangbuchs in den Glauben und in die Verherrlichung Gottes hineingewachsen. Der Größe und Ehre Gottes dienten des weiteren die Kirchenbauten, die in der Amtszeit Steins errichtet wurden. Allein am Untermain entstanden stattliche Gotteshäuser in Goldbach, Hösbach, Schweinheim und Wörth.
Das Testament
100 Jahre sind vergangen, seit die letztwillige Verfügung des am 4. Juni 1909 verstorbenen Erzbischofs bekannt wurde. Sie bedachte die Diözese Würzburg mit mehreren Stiftungen. Am Ende des Testaments bat Bischof Franz Joseph die Christen der Diözesen Würzburg und München um Verzeihung. Er, der so viel Gutes getan hat, schreibt: „Möge mir der Herr für die Fehler und Irrungen, deren ich mich in meinem hohen Amt schuldig gemacht, seine überreiche Barmherzigkeit angedeihen lassen!“ Dann wünschte er den beiden Diözesen den Schutz und Segen Gottes. Seine letzten Worte sind ein geistliches Testament, das auch für uns heute noch gilt. Sie lauten: Der gnädige und barmherzige Gott „erhalte und befestige sie im heiligen katholischen Glauben. Er bewahre sie in unauflöslicher Gemeinschaft mit der einen und heiligen, katholischen und apostolischen Kirche und mit ihrem sichtbaren Oberhaupte auf dem Stuhle Petri! Er leite sie zu einem wahrhaft christkatholischen Leben und führe ihre Angehörigen alle zum ewigen seligen Leben und vereinige sie dort mit allen ihren ehemaligen Priestern und sterblichen Oberhirten mit dem ewigen hohen Priester Jesus Christus!“
Amen.