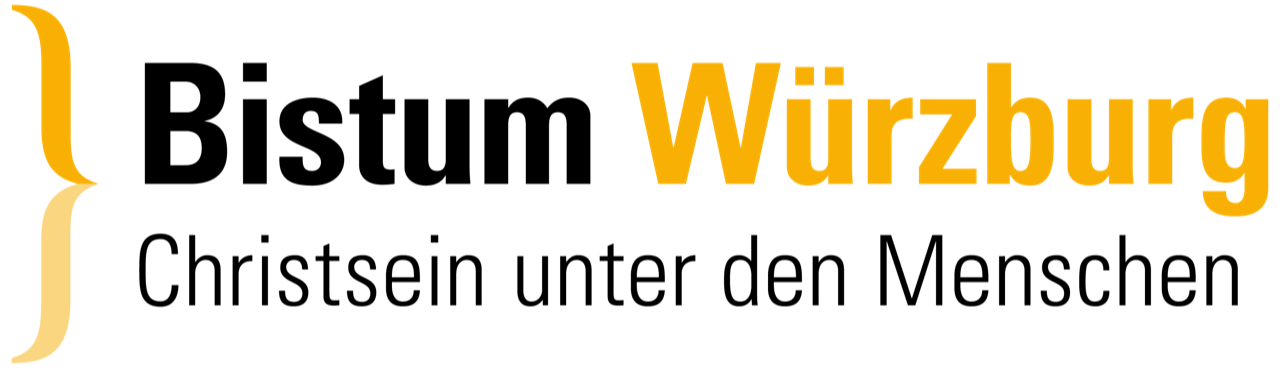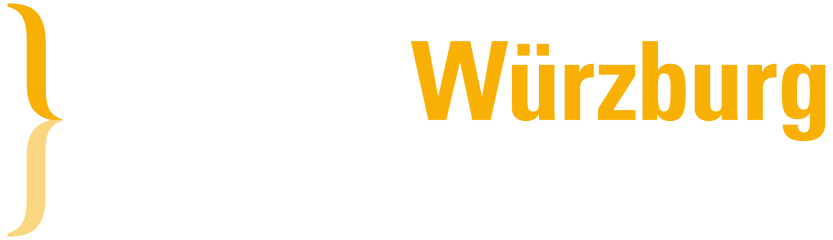Gadheim (POW) Die Inhalte des neuen Patientenverfügungs-Gesetzes hat Martina Mirus, Diözesanoberin und Hospizbeauftragte des Malteser-Hilfsdiensts, der diözesanen Caritas-Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe in Gadheim vorgestellt. Der Arbeitsgemeinschaft gehören 103 ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen an.
Wer kann sich schon vorstellen, im hohen Alter aufgrund Unfall, Krankheit oder Demenz seinen Alltag nicht mehr selbst regeln oder seinen Willen nicht mehr ausdrücken zu können? Was passiert mit solchen Menschen, wenn niemand weiß, wie und ob sie behandelt werden wollen? Die juristische Grauzone zwischen Behandlungspflicht und Körperverletzung hat der Bundestag zum 1. September 2009 erstmals mit einem Gesetz zu Patientenverfügung geregelt.
Für Patientenverfügungen sei die Schriftform zwingend vorgesehen, sagte Mirus. Nur so könne der Wille eines nicht mehr ansprechbaren Patienten zu Untersuchungen oder Behandlungen berücksichtigt werden. Fehle die Schriftform, sei eine gerichtlich bestellte Befragung nötig. Bei vielen Standartpatientenverfügungen zum Ankreuzen, die man sich aus dem Internet herunterladen könne, fehle der Raum zur Formulierung persönlicher Werte und Lebensvorstellungen und der eigenen Biografie. Hierauf aber legten die Gerichte im Zweifelsfall den größten Wert, erläuterte die Referentin. Die sogenannte christliche Patientenverfügung und die Formulare der Malteser, die bundesweit die größte Erfahrung im Hospizbereich hätten, verfügten über diesen Passus. Formulare zum Ankreuzen hingegen ermöglichten Manipulationen.
Stehen Patienten unter Betreuung oder haben sie einen Bevollmächtigten, müssten diese prüfen, ob der Inhalt der Patientenverfügung die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation des Patienten beschreibt. Liege keine entsprechende Verfügung vor, müsse der Betreuer oder Bevollmächtigte den mutmaßlichen Willen des Patienten feststellen und entscheiden, ob eine Einwilligung zur Behandlung erteilt wird. Kein leichtes Unterfangen, denn hierzu müssen mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische, religiöse Überzeugungen oder persönliche Wertvorstellungen des Betreuten erforscht werden. Berufsbetreuer, die 40 und mehr Menschen betreuten und sie persönlich oft kaum kennen würden, würden sich hier schwer tun. Die Tragweite dieser Regelung zeige eine 2007 erstellte Umfrage bei bundesdeutschen Vormundschaftsgerichten. 55 Prozent der Richter hätten angegeben, nicht auf den Patienten, sondern den Betreuer gehört zu haben.
Geregelt wurde auch ein Dialogverfahren zwischen behandelnden Arzt und Betreuer. Der Arzt muss jetzt prüfen, welche medizinischen Maßnahmen für den Patienten angebracht sind und sie unter Berücksichtigung des Patientenwillens mit dem Betreuer oder dem Bevollmächtigten absprechen. Wenn es keine Verzögerung bedeutet, muss er die Maßnahmen auch mit nahen Angehörigen oder Vertrauenspersonen abstimmen. Stimmt der Betreuer oder Bevollmächtigter künstlicher Ernährung, Beatmung oder Reanimation nicht zu, obwohl dem Patient der Tod oder schwere gesundheitliche Schäden drohen, muss sich der Arzt die Maßnahmen vom Betreuungsgericht genehmigen lassen.
Niemand könne jedoch gezwungen werden, eine Patientenverfügung zu erstellen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürften sie auch nicht zwingend bei Aufnahme oder Behandlungsbeginn verlangen, sagte Mirus. Einmal gegebene Verfügungen könnten jederzeit formlos widerrufen werden.
(1310/0444; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Foto abrufbar im Internet